Weltweit haben Regierungen im Jahr der Pandemie Fiskal- und Stimulierungsprogramme eines bislang ungeahnten Ausmaßes auf den Weg gebracht und verabschiedet, welche die ohnehin bis dahin bereits turmhohe Verschuldung in noch luftigere Höhen hat klettern lassen.
Gleichzeitig wird die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten wohl auch über die nächsten Quartale frische Liquidität in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar (!) in die Finanzmärkte pumpen.
Im Rahmen ihrer jüngsten Zinssitzung hatte sich auch die Europäische Zentralbank zu ihrem QE-Programm bekannt, darauf hinweisend, die eigenen Bondkäufe noch stärker expandieren zu wollen.
Selbstverständlich richten sich die Blicke auf die internationalen Währungsmärkte, an denen es sich insbesondere klassische Exportnationen nicht leisten können, wenn deren Währungen in Relation zu anderen Devisenkursen zu schnell und zu stark steigen. Aus aktueller Sicht ist der Euro hierfür eines der besten Beispiele.
Eine ganze Menge deutet darauf hin, dass sich die durch nichts gedeckten Fiat-Währungen in einer Art Endspiel befinden, vor dessen Einsetzen der ehemalige Finanzminister Brasiliens, Guido Mantega, schon im Jahr 2010 gewarnt hatte.
Ein Blick in die Schwellenländer zeigt, dass es Nationen wie Argentinien, der Türkei, Indien, Südafrika oder auch Brasilien immer schwerer zu fallen scheint, internationale Anleger von einer Stabilität von deren Fiat-Währungen zu überzeugen.
Nachdem der Bitcoin-Markt in der Türkei nach dem dort jüngst ausgesprochenen Verbot komplett auseinanderfällt, werden sich viele Türken und Türkinnen jetzt die Frage stellen, welche Anlagealternativen zur Verfügung stehen, um die eigenen Ersparnisse vor einem weiteren Kaufkraft-Verlustschub zu bewahren und die türkische Lira abzustoßen.
Länder wie Venezuela haben diesen Prozess nach dem Ausbruch einer Hyperinflation bereits hinter sich. Inzwischen ist die breite Masse vor Ort verarmt, während sich die Flucht aus dem südamerikanischen Land beschleunigt.
Auch in der Eurozone bekommen Sparer und Kontenkunden der Banken die Auswirkungen der finanziellen Repression nun erstmals so richtig am eigenen Leib zu spüren, da die meisten kommerziellen Geschäftsbanken den Minuszins der EZB mittlerweile an ihre eigenen Kunden weitergeben. Solange dies noch nicht der Fall war, wollten es viele wohl nicht wahrhaben.
Den Menschen, insbesondere Sparern, scheint mehr und mehr bewusst zu werden, auch wenn es sich um einen langsamen und schleichenden Prozess handelt, dass auf Konten deponiertes Geld wohl besser zu verausgaben ist, um für dessen aktuellen Gegenwert reale Produkte und Sachgüter zu erwerben, anstatt auch weiterhin der Hoffnung auf einen Erhalt der allgemeinen Kaufkraft des heimischen Geldes zu erliegen.
Kaum irgendwo anders als an Amerikas Märkten für Gebrauchtfahrzeuge lässt sich diese Entwicklung global betrachtet zurzeit besser beobachten. Monat für Monat steigen an diesen Märkten die Preise für gebrauchte Fahrzeuge auf neue Rekordhochs.
Auch die Holzpreise klettern in Amerika in immer luftigere Höhen, während sich ähnliche Beobachtungen rund um den Globus auch im Lebensmittelbereich anstellen lassen. Seitens offizieller Regierungsrepräsentanten wird die Inflationsgefahr – naturgemäß – auch weiterhin heruntergespielt.
Im Gegenteil wird weiteres Öl ins bereits lodernde Feuer gegossen, indem Ausgabeprogramm auf Ausgabeprogramm folgt, ganz so, als gäbe es kein Morgen mehr. Dass sich zumindest in den Vereinigten Staaten Ansätze eines geplanten Umverteilungsprogrammes – und zwar von oben nach unten – erkennen lassen, bleibt bislang eher eine Ausnahme.
So hat die Biden-Administration zuletzt angekündigt, die Kapitalertragssteuer in den USA von rund zwanzig Prozent auf 39,6 Prozent unter jährlichen Einkommen von mehr als einer Million US-Dollar anheben zu wollen.
Addiert man den Obamacare-Obolus mit in diese Kalkulation mit ein, so würde die Kapitalertragssteuer in den USA auf 43,4 Prozent, in den Bundesstaaten New York und Kalifornien sogar auf weit über fünfzig Prozent klettern, während Börsenplätze wie Hongkong inzwischen ihre Stempelsteuer angehoben haben.
Langsam aber sicher zeichnet sich – zumindest in den USA – eine Trendwende ab. Und zwar weg von der Finanzialisierung der Wirtschaft hin zu einer Auflage von Ausgabeprogrammen des Staates, die an den New Deal in den 1930iger Jahren erinnern. Es erweckt den Eindruck, als ob die Biden-Regierung ihre wohlhabenden Bürger dafür zur Kasse bitten wird.
Hinzu gesellt sich der Plan, die amerikanischen Unternehmenssteuern wieder auf 28 Prozent zu erhöhen, was sich anscheinend nur dann durchsetzen ließe, wenn die G20-Länder ihre Bereitschaft zu einer durch US-Finanzministerin Yellen angestoßenen Harmonisierung der in diesen Gefilden herrschenden Steuersysteme zeigen würden.
Übersetzt heißt das so etwas wie, „wir hier in Amerika sind pleite, und wir brauchen dringend Geld aus allen möglichen Kanälen – also zieht mit, um den Status des US-Dollars als Weltreservewährung aufrechtzuerhalten und den amerikanischen Verbrauchermarkt vor schweren Einbrüchen „zu retten“, die Euch alle anderen auf der Welt selbst einholen würden“.
Ob auch die Reichen und vor allem die großen Konzerne wie Apple und Amazon Pläne dieser Art mittragen werden? Nichts Genaues weiß man nicht, zumindest bislang nicht. Wer allein nur auf aktuelle Charts zur Entwicklung der amerikanischen Geldmenge blickt, erkennt, dass dieses Spielchen nicht auf ewig so weitergehen kann.
Hinzu gesellen sich in vielerlei Bereichen viel zu niedrige Bestände, Lieferkettenprobleme, teils massiv steigende Transportkosten sowie eine wachsende Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen und Konsumgütern in den Industrieländern.
Die aktuelle Lage an den Märkten für Gebrauchtfahrzeuge in den Vereinigten Staaten zeigt in prägnanter Weise auf, dass es angesichts von derzeit stark steigenden Preisen (noch) nicht zu einem Käuferstreik gekommen ist – ganz im Gegenteil. Diese Entwicklung verheißt gewiss nichts Gutes aus Sicht des allgemeinen Vertrauens in die heimische Währung!
Die über die vergangenen Monate eingegangenen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) stützen diese Sichtweise, da sich amerikanische Hersteller problemlos dazu in der Lage sehen, ihre kletternden Einkaufspreise auf die eigenen Kunden in der Heimat abzuwälzen.
Vielmehr lässt sich ein sich beschleunigender Run auf eine ganze Reihe von Gebrauchs- und Konsumgütern in den USA beobachten, der selbstverständlich inflationär wirkt. Haben die Menschen erst einmal das Gefühl, Produkte lieber sofort zu erwerben – anstatt weiter zuzuwarten – könnte sich eine inflationäre Spirale in Gang setzen.
Kehren wir zurück zu den Schwellenländern. Insbesondere hier haben viele Nationen mit einer teils deutlich steigenden Inflation zu kämpfen, die sich vor allem anhand von steigenden Importpreisen aufgrund von anhaltend abwertenden Währungen herleitet.
Blicken wir auf Mexiko, wo die Verbraucherpreise allein im Monat März laut offiziellen Angaben um 4,7 Prozent gestiegen sind. Mittlerweile ist die allgemeine Preisentwicklung über den durch die Bank of Mexico eigens verorteten Zielsatz in Höhe von drei Prozent hinausgeschossen.
Unter jenen durch die Preissteigerungen am stärksten betroffenen Produkten befanden sich neben Erdgas und Benzin unter anderem auch Lebensmittelprodukte wie Eier und Mehl. Die kletternden Rohstoffpreise fressen sich inzwischen in die Endverbraucherpreise hinein.
Ein gutes Beispiel bilden die Maispreise, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate im Durchschnitt um 75 Prozent gestiegen sind. Seit letztem Sommer klettern auch die Weizen- und Getreidepreise beständig.
In Mexiko übersetzte sich diese Entwicklung im März in einen Anstieg der Tortilla-Preise in Höhe von drei Prozent im Vergleich mit dem Vormonat. Hinzu gesellt sich die Tatsache, dass die mexikanische Wirtschaft im Gesamtjahr 2020 um 8,5 Prozent geschrumpft ist, womit der schärfste Wirtschaftseinbruch seit der großen Depression in den 1930iger Jahren einherging.
Inzwischen beginnt sich abzuzeichnen, dass sich die Preisentwicklung hiervon unbeeindruckt zu zeigen scheint. Vielmehr ist es wohl auch im ersten Quartal des laufenden Jahres zu einer Schrumpfung der mexikanischen Wirtschaft, die aufgrund von Angebotsengpässen in der Breite nicht mehr deflationär wirkt, gekommen.
Der geldpolitische Spielraum der Bank of Mexico wird aufgrund einer sich abzeichnenden Stagflation (oder „Schrumpfflation“, Vorsicht, es handelt sich um meine eigene Wortwahl), immer geringer. Die Zentralbank kann den eigenen Leitzins in diesem Umfeld nicht noch einmal senken.
Vielmehr könnte sich die Bank of Mexico schon bald dazu gezwungen sehen, den Leitzins anzuheben, so wie dies in der vergangenen Woche in Russland geschehen ist, wo es aus Sicht von vielen Beobachtern gänzlich unerwartet zu einer Leitzinserhöhung von gleich fünfzig Basispunkten (0,5 Prozentpunkte) gekommen ist.
Auch in Brasilien war es schon vor rund drei Wochen zu einer ähnlichen Entwicklung gekommen. Die in vielerlei Bereichen teilweise stark zulegende Inflation veranlasste die brasilianische Notenbank zu einer Anhebung des heimischen Leitzinses um 75 Basispunkte (!) auf 2,75 Prozent. Es handelte sich hierbei vor Ort um die erste Zinsanhebung innerhalb der letzten sechs Jahre.
Schon im Monat Mai könnte es in Brasilien nochmals zu einer Anhebung des Leitzinses um weitere 75 Basispunkte kommen, so die Zentralbank, falls sich die Inflation nicht eindämmen ließe. Es lässt sich durchaus mit einem solchen Szenario rechnen, da sich Zinsanhebungen erst mit einiger zeitlicher Verzögerung auf die Verbraucherpreisentwicklung auswirken.
Allein im März kletterte der brasilianische Verbraucherpreisindex laut offiziellen Angaben um 6,1 Prozent. Auch in Brasilien ist die Inflation damit inzwischen über jenes durch die Zentralbank eigens gesetzte Maximalinflationsziel in Höhe von 5,25% hinausgeschossen.
Von der Front der brasilianischen Produzentenpreise gehen ebenfalls keine guten Neuigkeiten ein, nachdem die Preise in diesem wichtigen Bereich im Monat Februar im schnellsten Tempo seit Beginn der Datenaufzeichnungen geklettert sind.
Auf Monatsbasis legten die Produzentenpreise in Brasilien im Februar um stattliche 5,2 Prozent zu, während es auf Jahresbasis zu einem Anstieg von 28,6 Prozent (!) kam. Neben Rohstofferzeugnissen aus der heimischen Minenindustrie (+87,6 Prozent auf Jahresbasis) hat ebenfalls der Lebensmittelbereich mit einem jährlichen Anstieg von fast acht Prozent einen großen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet.
Es erklärt sich von selbst, dass in den lateinamerikanischen Nationen vor allem die armen Bevölkerungsschichten, die eine Mehrheit bilden, besonders hart durch diese Preisanstiege getroffen werden.
Es muss daher damit gerechnet werden, dass sich die zuletzt in den Jahren 2007 und 2017 landesweit aufflammenden Proteste schon bald wiederholen könnten. Dies gilt insbesondere dann, falls die Benzin- und Lebensmittelinflation nicht unter Kontrolle gebracht werden kann.
Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus, denn in Mexiko sind die Benzinpreise im Lauf des vergangenen Jahres um durchschnittlich dreißig Prozent geklettert, während die Preise für Diesel in Brasilien allein im letzten Monat um gut elf Prozent gestiegen sind.
Steigende Energiepreise führen für gewöhnlich wiederum zu einer Preissteigerung im Agrar- und Landwirtschaftssektor. Ebenso wie Fed-Chef Jerome Powell gehen die Verantwortlichen bei der brasilianischen Zentralbank von einem „temporären Inflationsphänomen“ aus, das sich auf Sicht verflüchtigen wird.
Wirklich? Warum hebt Brasiliens Zentralbank dann in einem derart starken Ausmaß den eigenen Leitzins an?! Ferner lässt sich aufgrund von Beobachtungen in der Vergangenheit behaupten, dass sich Inflation, wenn einmal aus der Flasche entronnen, nicht wieder so einfach in diese Flasche zurückbugsieren lässt.
Hierfür bedarf es, vielleicht ähnlich der Entwicklung in den USA in den 1970iger und 1980iger Jahren, einer sehr starken Anhebung des Leitzinses (damals auf bis zu zwanzig Prozent), um diesen Geist zu zähmen. Über einen solchen Spielraum verfügen Zentralbanken aufgrund einer turmhohen Verschuldung rund um den Globus heutzutage jedoch nicht mehr.
Die Wirtschaften würden in einem solchen Fall dermaßen stark einbrechen, dass es wohl nicht lange dauern würde, bis es zum Ausbruch von gefährlichen Sozialunruhen kommen würde. „In die Falle getappt, Zentralbanken“, wie sich diese Entwicklung übersetzen ließe.
Wiederholt deuteten Zentralbanken angesichts ihrer immer rücksichtsloseren QE-Programme darauf hin, dass auf diese Weise Zeit erkauft werden sollte. Zeit für was? Regierungen rund um den Globus waren bis dato zu feige, um die dringend benötigten Strukturreformen auf den Weg zu bringen, welche neben dem Banken- auch das Finanz- und Wirtschaftssystem auf eine solidere Basis gestellt hätten (ganz zu schweigen von ausufernden Sozialstaaten).
Gewiss wäre es ein schmerzhafter Prozess gewesen, welcher den einzelnen Bevölkerungen kommunikativ hätte vermittelt werden müssen. Geschehen ist allerdings nichts. Ex-Präsident Obama hatte die einzigartige Chance, diesen Prozess in die Wege zu leiten. Die Herzen flogen ihm bei seinem Amtsantritt nur so zu.
Doch anstatt die Verursacher der globalen Finanzkrise für deren Handeln zur Kasse zu bitten, erwies es sich damals noch als der bequemere Weg, einfach nichts zu tun oder Steuergelder en masse zugunsten von Banken- und Automobilbauer-Bailouts zu verausgaben.
Auf diese Weise wurden private Verluste sozialisiert, und was ist das Ende vom Lied? Hierzu blicken wir in diesen Tagen einfach in die Türkei, wo es ein Bitcoin-Verbot nicht tun wird, um die anhaltende Flucht aus der heimischen Währung zu stoppen.
Vielmehr wächst das Misstrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung in Ankara sowohl unter heimischen als auch ausländischen Investoren mit jeder verstreichenden Woche. Den Handel mit Bitcoins zu verbieten erweist sich eigentlich nur als eine Geste der Ohnmacht, die sinnbildlich als Synonym eines Mottos namens „Immer weiter so bis zum Klippensturz“ steht.
Zurück zum südamerikanischen Kontinent. Während die Hyperinflation in Venezuela um sich greift und Argentinien sich auf bestem Wege befindet, um als nächstes Land in der Region in diese Fußstapfen zu treten, lassen sich in einer Reihe von anderen südamerikanischen Ländern bislang noch gänzlich gegensätzliche Beobachtungen machen.
Angefangen bei Kolumbien, wo die Inflation im März offiziell bei 1,5 Prozent – und damit weniger als halb so hoch wie vor einem Jahr – lag, über Peru (2,6 Prozent), Uruguay (drei Prozent) und Chile (2,9 Prozent) bis hin zu Ecuador (-0,8 Prozent), kommt es in der Region (noch) zu teils deutlichen Abweichungen und Divergenzen.
In Argentinien wurde im Monat März dagegen eine Inflation von 42,6 Prozent auf Jahresbasis gemessen. Doch nahezu alle lateinamerikanischen Nationen haben in der jüngeren Geschichte teils sehr schmerzhafte Erfahrungen mit inflationären Entwicklungen gemacht.
Ecuador mit dem Sucre, Mexiko ehedem in den 1980iger Jahren, wo eine über einhundert Prozent kletternde Inflation damals große Teile einer zarten Mittelschicht enteignete. Auch Brasilien weiß sich wohl noch gut an eine mehr als sechstausend-prozentige Inflation in den 1990iger Jahren zu erinnern.
„Was heißt das für mich konkret!?“
Nach wie vor befindet sich das Gros unseres Planeten in einem Schwebezustand zwischen Deflation und Inflation. Diese Situation kann sich aufgrund von anhaltenden Lieferengpässen und Bergen von elektronisch frisch erzeugtem Geld jedoch ganz schnell ändern. Was wollen Zentralbanken wie die Fed tun, wenn die heimische Inflation auch dort die eigens gesetzten Zielbänder (vielleicht deutlich?) überschreiten sollte?
Wahrscheinlich würde es sich als klug erweisen, die offiziellen Aussagen nach Art von „Es handelt sich nur um ein temporäres Inflationsphänomen“ in deren Gegenteil umzukehren, um der Wahrheit näher auf die Spur zu kommen.
Jeder erinnert sich wahrscheinlich noch an: „Es gibt keine Absicht, eine Mauer zu bauen“. Aus dieser Perspektive dürfte es weise sein, dem allgemeinen Trend zu folgen, um lebenslang aufgebaute Ersparnisse spätestens jetzt in Realgüter (egal, welcher Form, Hauptsache brauch- und einsetzbar) beziehungsweise Sachgüter einzutauschen.
Diese Empfehlung gilt zumindest für all jene, die hiermit über die vergangenen Jahre noch nicht begonnen haben sollten. Denken Sie weniger in Papier als vielmehr an Dinge, die Sie fest in der Hand halten können!













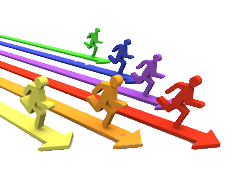
Kommentare
Und das was in Venezuela, und Zimbabwe, bezüglich der Hyperinflation passierte, kann uns niemals passieren, da wir deren Fehler einer Zinserhöhung niemals machen werden...
...und wenn dann doch eine galoppierende oder Hyperinflation kommen sollte, dann wird in die Keksdose (Geldvermögen) der Bürger gegriffen, schliesslich ist laut einige der besten Zeitungen, der Deutsche sehr reich, 70% fordern sogar eine Vermögensabgabe, da es uns allen sehr gut geht ;)
Ich kann mich auch an keiner einzelnen Währungsreform in Europa erinnern, woran das wohl liegt.
(*Ironie aus)
"Diesmal ist alles anders" (This time is different), und "dies konnte niemand voraussehen", werden wieder einmal zwei sehr teure Sätze / Philosophien sein, wenn es dann mal richtig knallt.
Bleiben Sie Gesund und munter.
Gruss
Michael
Da gibt es nichts hinzuzufügen.
Bleiben sie gesund
In Berlin beschließen sie neue Gesetzte welche die Wirtschaft insbesondere die Klein - und Mittelbetriebe in den Ruin treiben. Was macht DAX und Co. Hurra neue Rekorde. Da findet man keine Worte mehr denn dieser Irrsinn findet Weltweit statt, aber Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Danach hat es natürlich wieder niemand gewußt da sind wir Deutschen ja Weltmeister drin.
Ich interpretiere das mal so: Der Hegemon macht der übrigen Welt »ein Angebot das sie nicht ablehnen kann.« Frei nach Don Corleone ;–).
Aber die Wege zu so einem Angebot mögen unergründlich sein.
Wenn ich als reicher Konzern es bereits geschafft habe, ein Teil des Staates zu werden, dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich höhere Steuern bezahlen muss, weil sie irgendwie dann ja "in der Familie" bleiben? Ha... sollten sich die Platzhirschen da nicht groß wehren, dann wohl, weil sie bereits den Fuß in eine andere Dimension gesetzt haben? In eine Dimension, in der die globale Überbevölkerung ein kleineres Problem darstellt, als die Anzahl der Reichen? Eine Sience-Fiction-Spekulation...
Wir leben immer noch in der Blase, wo die Fehler der Vergangenheit von denen korrigiert werden, die sie begangen haben - bewusst oder unbewusst. Die Korrekturenmischung wird von einer Schar Instanzen / Regierungen angerührt, welche sicherlich auch aus den besten und notwendigsten Absichten handeln, auch wenn sie eine Schlinge um ihren Hals spüren mögen, die ihnen von "penetranten oder gar erpresserischen Beraterkreisen" freundlich übergestreift wurde.
Man darf die Zukunft nicht einfach den globalgesellschaftlichen Strömungen überlassen, außer wenn man sie selbst dahin gesteuert hat und auch die Stromschnellen schon kennt. Aber das ist ja ein alter Hut, dass nichts wertvoller ist, als Informationen. Das hat früher jeder kapiert und gilt heute noch, war das nicht eine Rothschild-Maxime? Du must der erste in der Informationskette sein!
Wie gesagt... alter Hut. Und etwas stressig. Nun kann man zwar die Zeit nicht zurück gehen, aber mit Hilfe der Manipulation kannst du Informationen berechnen, bevor sie überhaupt "verfügbar" sind. Hm... also doch irgendwie eine Art Glaskugel...
Ich muss mal wieder die Feuerwehr als Beispiel heranziehen bezüglich deren Effektivität: Lege die Brände selbst, bevor es der Zufall oder ein anderer macht. Hast du die Brandstifter mit an Bord, können sie auch genau die Brände legen, wo du sie gerne hättest. Du wirst da sogar noch zum Helden nebenbei. Nun ist es so, dass jeder selbst gelegte Brand trotzdem ausufern kann, weil nicht alle Parameter berücksichtigt werden können. Heißt, du kannst trotzdem noch die Kontrolle verlieren. Aber: als "Vorstand" der Feuerwehr weißt du das sicher als erster, deswegen kannst du notfalls bestimmte Assets... ehh ich meine Areale "abstoßen", die nicht mehr zu retten sind vor den Flammen. Dann kannst du dich mit deinen "Eingeweihten" auf eine Anhöhe begeben und zusehen, was im Tal da unten alles abfackelt. Danach musst du nur höllisch aufpassen, dass niemanden auffällt, dass du nur von der Außenlinie zugeguckt hast und gar nichts in dem Inferno groß verloren hast....
Die Geschichte kann man weiter spinnen, du einigst dich mit der Meute, einen Teil deines unversehrten Besitzes an sie abzugeben, bevor sie mit den Mistgabeln auf dich losgeht. Du bist natürlich so schlau, dein "Geschenk" an die Meute so auszusuchen, dass es ohne deine Kontrolle darüber gar nichts wert ist. Dann hast du sogar einen "nicht geplanten Zwischenfall" in deinem Weg nach oben meisterlich integriert. Aber noch ist ja kein Brand ausgebrochen, der nicht eingeplant war, oder?